Wunschdenken – Wissen war einmal Macht
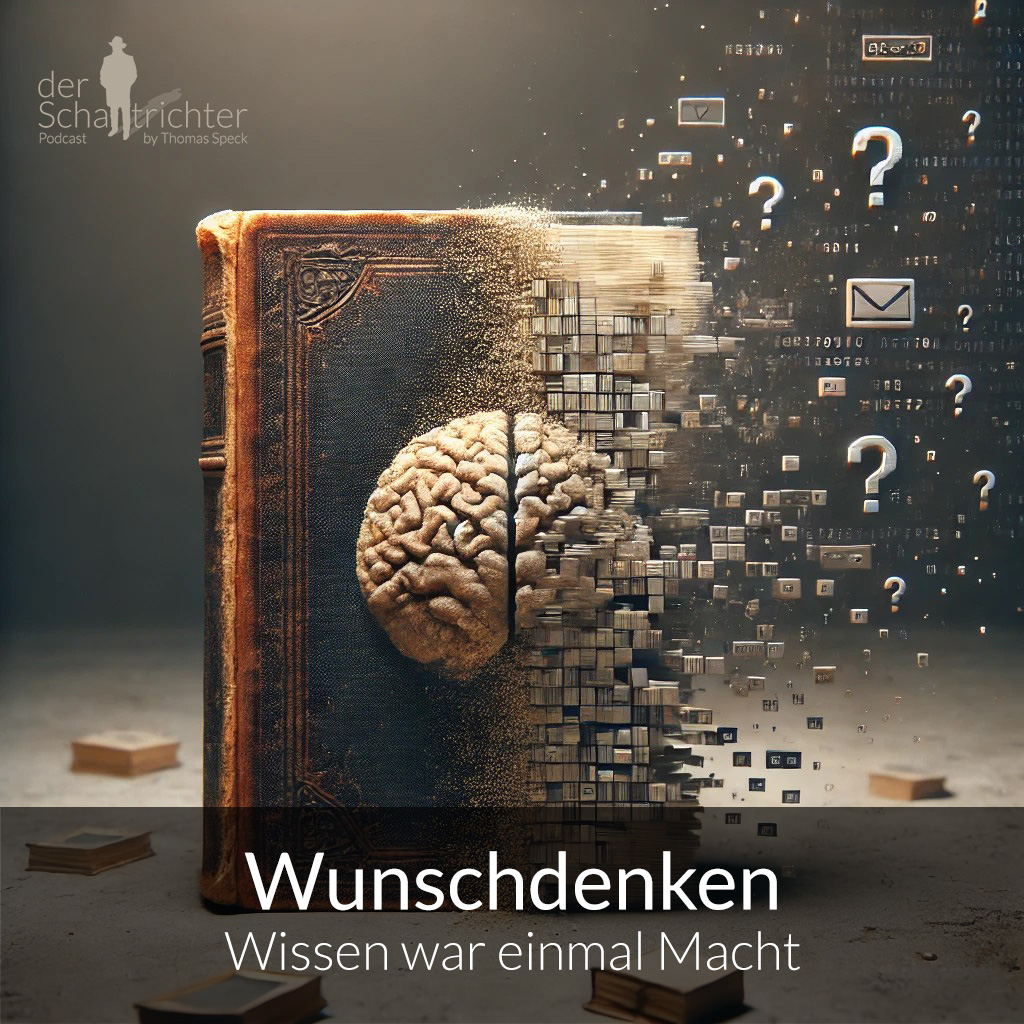
Heute reicht ja ein Wisch über den Bildschirm, und Google liefert uns zehn Antworten in fünf Millisekunden. Aber Thomas fragt provokant: Macht uns das wirklich schlauer? Oder sind wir nur noch hyperaktive Waschbären, die glänzendes Zeug hin- und herdrehen, ohne je wirklich zu verstehen, was sie in den Händen halten?
Wissen. Ein geheimnisvolles, beinahe mythisches Etwas, das man einst wie einen heiligen Gral suchte. Ja, es gab Zeiten – tief in der Historie des 20 Jahrhunderts verborgen – da war Wissen nicht einfach ein permanenter Begleiter in deiner Hosentasche, der dir auf Knopfdruck Antworten lieferte. Wissen zu erlangen war ein echter Kampf – ein episches Abenteuer, das nur jene beschritten, die bereit waren, sich den Gefahren der Suche zu stellen.
Damals, als die Welt noch analog ticken musste, hieß es: ab in die Bibliothek. Und das war keine einfache Sache, oh nein! Es bedeutete, tatsächlich physisch aufzubrechen, als wäre man auf einer Quest, das Zauberbuch zu finden, das in einem Labyrinth von verstaubten Regalen verborgen lag. Man stellte sich der gefürchteten Herausforderung der Karteikarten in einer Bibliothek, einem kryptischen System, das heute so altmodisch wirkt wie die Idee, dass man Bücher aus echtem Papier drucken muss. Man benötigte Zeit, Geduld und vor allem die Bereitschaft, oft Wochen – ja, Monatelang täglich diese heiligen hallen aufzusuchen, nur für die vage Hoffnung, das das Buch, das du für deine Studien benötigst, endlich von Vormieter zurückgegeben wurde.
Und dann, oh dann, wenn man endlich auf das Wissen stieß – eine Passage in einem verstaubten Enzyklopädie-Band oder die erleuchtenden Worte eines schrulligen Professors – fühlte es sich an, als hätte man den heiligen Gral gehoben. Das war Wissen, damals: Es war Arbeit. Es war Kampf. Es war… hart erarbeitet. Wie eine per Hand gemeißelte Statue, nicht wie eine auf TikTok generierte 5-Sekunden-Info-Dosis.
Man war stolz darauf, dass man nicht alles auswendig rezitieren konnte, sondern dass man wusste, wo man das nötige Wissen finden konnte. Aber der Unterschied zu heute? Das „Wo“ war nicht nur eine Frage von Sekunden und Suchmaschinen. Es bedeutete, in den verstaubten Ecken der Realität zu graben, wo die Informationen nicht sofort aufleuchteten und einen von selbst ansprangen. Ja, Google weiß auch, wo man suchen muss – aber Google sagt dir auch, was du hören willst. Es überhäuft dich mit einer Flut von Antworten, die auf Dir und Deinen Surfgewohnheiten angepassten Algorithmen beruhen und nicht auf deiner Fähigkeit, den Faden zu entwirren.
Damals, als man durch dicke Bücher blätterte und manchmal Stunden für ein kleines Detail aufbrachte, geschah etwas Entscheidendes: Das Suchen selbst war das Lernen. Man stieß auf Zusammenhänge, die man gar nicht gesucht hatte, verknüpfte Informationen, die sich am Wegesrand versteckten, und am Ende verstand man mehr, als man ursprünglich wollte. Es war nicht einfach nur ein „Hier ist die Antwort, auf Wiedersehen“, sondern eine Expedition in die Tiefen des Wissens, die das eigene Denken formte.
Und das war der wahre Schatz: Wissen war nicht nur eine Sammlung von Informationen, es war ein Muskel, der durch die Arbeit trainiert wurde. Das Analoge zwang einen, sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren und nicht einfach die erstbeste Antwort zu akzeptieren, die man nach einem schnellen Klick präsentiert bekam. Heute gibt dir Google zehn Antworten in fünf Millisekunden – und keine davon fordert dich heraus, zu hinterfragen, was Genau du eigentlich wissen wolltest.
Wissen war eine Fähigkeit, die der Zeit und des Willens bedurfte – keine flüchtige Push-Benachrichtigung.
Aber das soll natürlich nicht heißen, dass es früher besser war. Oh nein. Es war nur… anders.
Das zumindest ist die übliche Floskel, mit der wir älteren Menschen den Vorhaltungen der Jungen heute begegnen.
Sie ist an vielen Stellen schlicht gelogen, nur gesagt, um seine Ruhe zu haben.
Denn in vielen Dingen war es früher besser. Heute braucht es schon Fachbegriffe für die Zustände, in die die junge Generation gerät, wenn man den heutigen Wissenskonsum beschreiben will – googelt mal das Wort Technoferenz – ein Kofferwort aus Technologie und Interferenz.
Technoferenz – Dann wisst ihr auch, warum schnelles Wissen weniger wert ist, als tiefes Wissen.
Ich liebte und liebe Bibliotheken.
Das wahren die Tempel der Gelehrten, heute eher das Domizil einer vom Aussterben bedrohten Spezies. Wer sich heute in die heiligen Hallen eines solchen Gebäudes verirrt, ist entweder hoffnungslos verloren, ein Kulturrelikt, das irgendwo zwischen Staub und Schimmel zur Selbstfindung aufgebrochen ist oder ein rettungsloser Nostalgiker, der den alten Werten hinterherweint.
Hier – in der Bibliothek – gibt es keine Suchleiste, keinen „Ich fühle mich glücklich“-Button, der dir die Antworten direkt auf den Screen serviert. Nein, hier wartest du. Auf Bücher. Die müssen oft erst aus einem dunklen Lager geholt werden, in dem die Zeit um 1980 stehengeblieben ist – ein Tempel, der heute nur noch von jenen betreten wird, die „Papier“ nicht als Witz, sondern als Medium verstehen.
Und während draußen die Welt in Sekunden alles „liked“, stehen die Verirrten in diesen heiligen Hallen herum und… denken nach. Sie blättern sogar noch um. Ja, physisch! Eine vergessene Kunst, wie Bogenschießen oder Brieftauben.
Aber auch das ist Teil der Illusion: Bibliothek ist für viele nur noch eine Bühne, auf der sich die letzten Verfechter des Denkens ein Stelldichein geben, während draußen jeder auf die nächste Pull-Benachrichtigung wartet. Wissen? Das gibt es nicht mehr im Regal, sondern im Sekunden-Feuerwerk der Sinneseindrücke. Wer will sich noch durch Bücher wühlen, wenn ein schneller Wisch mit dem Finger genügt? Große alte bibliotheken sind heute kaum mehr als ein Touristen-Gag, so wie ein Museumsbesuch – „Schaut, Kinder, so sah Wissen früher aus!“ Nebenbei bieten alte Bibliotheken eine schöne Kulisse für leblose Selfies auf Instagram – derlei Treiben kann in der Admonter Stiftsbibliothek regelmäßig beobachtet werden.
Gerade eben wusste ich noch nicht, wie ich diese Geschichte weiter schreibe, aber da kam er: mein finaler Gedanke – als ich nämlich an die damalige Langsamkeit dachte.
Ein winziger, aber zündender Moment der Erkenntnis, der plötzlich klarstellt, dass dieses „Wissen“, das wir uns heute ständig vor die Nase halten, nichts weiter ist als digitales Fast Food. Schnell konsumiert, noch schneller vergessen. Wer will sich noch erinnern? Ist doch egal, kanns ja nochmal googeln.
Man könnte meinen, am Beginn des 3. Jahrtausends, dem goldenen Zeitalter der Information, würden wir als Menschen über ein Wissensarsenal verfügen, das jeden Universalgelehrten des 18. Jahrhunderts vor Neid erblassen ließe. Aber nein. Stattdessen stehen wir da, wie hyperaktive Waschbären, die glänzendes Zeug in ihren Händen hin- und herdrehen, nur um es dann wieder fallen zu lassen, weil… naja, wer hat denn Zeit, tatsächlich nachzudenken?
Ja, wir sind alle Experten. Experten im Scrollen, Swipen und Liken. „Oh, hast du das Video von der Katze gesehen, die Klavier spielt?“ „Klar, hab ich geteilt.“ Es ist nicht so, dass wir nicht lesen könnten. Wir könnten. Aber das Lesen – das ernsthafte, konzentrierte Aufnehmen von Information – ist für uns heutzutage etwa so attraktiv wie ein Zahnarztbesuch. Wenn es keine blinkenden Lichter hat, mindestens drei Emojis und am besten in unter drei Sekunden zu konsumieren ist, dann ist es nichts für uns.
Natürlich haben wir auch alle diese Freunde, die uns von den neuesten Verschwörungstheorien erzählen. „Hast du gehört, dass der Mond eigentlich nur eine riesige Dyson Sphäre ist, was von der Regierung geheim gehalten wird?“ Nein, Janine, habe ich nicht. Aber danke, dass du mir das YouTube-Video geschickt hast, das die Wahrheit enthüllt.
Es ist schon faszinierend, wie wir uns selbst einreden, wir wären heute die klügste Generation aller Zeiten. Schließlich können wir jede Frage in Sekundenschnelle von der allmächtigen Suchmaschine beantworten lassen. Ich bin auch nicht frei davon. Wir fühlen uns wie kleine Götter des Wissens, die den gesamten Wissensschatz der Menschheit in der Hosentasche tragen – immer bereit, jede Diskussion mit einem schnellen Google-Fakt zu gewinnen. Aber was wir dabei wirklich lernen? Dass wir nicht wissen, was wir eigentlich wissen wollen. Statt uns tief in ein Thema zu graben, hüpfen wir wie dressierte Chihuahuas jedem Ping und jeder Benachrichtigung hinterher, immer in der Hoffnung, dass die nächste Info uns endlich schlauer macht. Spoiler: tut sie nicht!
Wir sind nicht klüger geworden, nur schneller. Wie ein Junkie, der immer auf den nächsten schnellen Schuss wartet, überfluten wir uns mit Wissen, das uns nichts bringt – außer der Illusion, dass wir alles im Griff haben.
Der Witz ist, dass wir nicht einmal wissen, dass wir nichts wissen. Es ist diese perfide Mischung aus Selbstüberschätzung und Gleichgültigkeit, die uns in der Komfortzone unserer Dummheit suhlen lässt. Während unsere Vorfahren noch hungrig nach Wissen waren – bereit, Berge zu erklimmen, um eine Schriftrolle zu ergattern – sitzen wir lieber mit einem Netflix-Abo und streiten uns darüber, ob es ethisch vertretbar ist, eine Avocado in der Mikrowelle zu erhitzen.
Wir geben uns die Illusion, informiert zu sein. Schließlich haben wir doch die Nachrichten-App auf dem Handy. Wir wissen ja alles, was wir wissen müssen. Und wenn es wichtig ist, kommt es sowieso als Push-Benachrichtigung, oder? Was dabei auf der Strecke bleibt, ist das größere Bild. Der Blick auf die Dinge, der uns erkennen lässt, dass das Leben komplexer ist als ein Twitter-Thread oder ein lustiges Meme.
Wir sind lieber die Zuschauer in diesem Theater der Ahnungslosigkeit, wo das Skript von Influencern, Algorithmus-Göttern und den neuesten TikTok-Trends geschrieben wird. Die Vorstellung, dass man auch mal weniger konsumieren könnte, um mehr zu verstehen, ist dabei ungefähr so absurd wie die Idee, dass Menschen ohne Social Media jemals überlebt haben.
Vielleicht sollten wir etwas wie eine „Wissenshygiene“ einführen?
So wie wir uns Detox-Tees einflößen und uns einreden, dass Selleriesaft die Lösung aller Probleme ist, könnten wir auch mal anfangen, unser Hirn vom ganzen digitalen Datenmüll zu reinigen. Kein Mensch würde sich den ganzen Tag über mit Fast Food vollstopfen, aber mit Informationsjunk machen wir das ganz entspannt. Tweets, Memes, endlose Artikel darüber, warum Avocados die Welt retten – alles in unsere Synapsen gepresst, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was das mit unserem geistigen Body Mass Index anstellt. Vielleicht sollten wir ja anfangen, unsere Informationsaufnahme so penibel zu kuratieren wie unsere Ernährung. Einen Gehirn-Detox, sozusagen: 10 Tage ohne Clickbait, und schon fühlt man sich wieder geistig erfrischt. Aber, Vorsicht – könnte ja passieren, dass man dabei anfängt, selbst nachzudenken.
Und wer will das schon? Nachdenken ist anstrengend.
Nachdenken ist mühsam. Irgendeine App wird das Denken schon für uns übernehmen.
Irgendwann.

